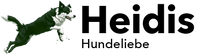Warum naturbelassene Nahrungsmittel für Hunde oft die bessere Wahl sind
Ob im Supermarktregal oder im Onlineshop – viele Hundefutterprodukte enthalten eine Vielzahl an Zusatzstoffen. Mal sind sie auf der Verpackung groß angekündigt, mal tauchen sie erst im Kleingedruckten auf. Doch was genau steckt eigentlich hinter diesen Zusätzen? Und welche Auswirkungen haben sie auf die Gesundheit deines Hundes?
In diesem Beitrag erfährst du:
- welche Arten von Zusatzstoffen es gibt,
- wann sie sinnvoll sein können,
- und warum du trotzdem besser auf naturbelassene Alternativen setzt.
Was sind Futterzusätze?
Futterzusätze – auch Additive genannt – sind Stoffe, die dem eigentlichen Futter beigemischt werden. Manche von ihnen haben eine funktionale Aufgabe (z. B. Haltbarkeit oder Nährstoffergänzung), andere dienen rein der Optik oder Geschmackstäuschung. Die Bandbreite reicht von unbedenklich bis problematisch – je nach Stoff, Dosierung und individueller Verträglichkeit.
Welche Arten von Zusatzstoffen gibt es?
1) Technologische Zusatzstoffe
Diese Zusatzstoffe sollen vor allem dafür sorgen, dass das Futter stabil bleibt, lange haltbar ist oder eine gleichmäßige Konsistenz hat. Sie haben also in erster Linie eine technologische Funktion – nicht unbedingt einen ernährungsphysiologischen Nutzen.
- Konservierungsstoffe: z. B. Sorbinsäure (E 200) oder Milchsäure (E 270) verlängern die Haltbarkeit. Bei synthetischen Varianten können empfindliche Hunde jedoch Haut- oder Verdauungsprobleme entwickeln.
- Antioxidantien: verhindern, dass Fette im Futter ranzig werden. Natürliche Varianten wie Vitamin E (E 307) oder Ascorbinsäure (E 300) sind unbedenklicher als synthetische Alternativen.
- Verdickungs- und Geliermittel: stabilisieren die Konsistenz von Nassfutter oder Snacks. Beispiele sind Carrageen oder Johannisbrotkernmehl. Manche Hunde reagieren darauf mit Durchfall oder Blähungen.
Viele dieser Stoffe gelten in geringen Mengen als unbedenklich. Problematisch wird es jedoch bei Überdosierungen, minderwertigen Rohstoffen oder wenn sie eingesetzt werden, um die Qualität optisch aufzuwerten.
2) Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Sie sollen einen direkten ernährungsphysiologischen Mehrwert bieten und dienen dazu, Nährstoffdefizite auszugleichen. Vor allem bei industriell hergestelltem Alleinfutter sind sie üblich, da Rohstoffe je nach Charge variieren können.
- Vitamine & Provitamine: z. B. Vitamin D oder Beta-Carotin. Sinnvoll, wenn sie gezielt dosiert werden – riskant bei Überversorgung.
- Spurenelemente: wie Zink oder Selen, die wichtig für Haut, Fell und Immunsystem sind.
- Aminosäuren: können die biologische Wertigkeit des Proteins verbessern, wenn bestimmte Bausteine in den Rohstoffen fehlen.
- Fettsäuren & Mineralstoffe: sichern die Versorgung mit essentiellen Nährstoffen.
Diese Zusätze können durchaus sinnvoll sein, solange sie hochwertig und nicht in Übermaß eingesetzt werden. Bei naturbelassenem, ausgewogenem Futter sind viele dieser Zusätze jedoch gar nicht nötig.
3) Zootechnische Zusatzstoffe
Hierbei handelt es sich um Stoffe, die die Verdauung oder das allgemeine Wohlbefinden verbessern sollen. Sie greifen direkt in Stoffwechsel- oder Verdauungsprozesse ein.
- Enzyme: helfen dabei, Nährstoffe leichter aufzuschließen und zu verwerten. Besonders hilfreich bei empfindlichen oder älteren Hunden.
- Probiotika & Präbiotika: unterstützen die Darmflora und können die Abwehrkräfte stärken. Sie sind oft in Spezialfuttern für Hunde mit Verdauungsproblemen enthalten.
Richtig eingesetzt können diese Zusätze sinnvoll sein. Allerdings sind die Effekte stark von der Qualität und der exakten Zusammensetzung abhängig – und nicht jedes beworbene „Probiotikum“ bringt tatsächlich messbaren Nutzen.
4) Sensorische Zusatzstoffe
Diese Kategorie umfasst alle Zusätze, die das Futter „attraktiver“ machen sollen – meist optisch oder geschmacklich. Sie haben keinerlei ernährungsphysiologischen Nutzen.
- Farb- und Aromastoffe: sorgen für eine ansprechende Optik oder einen intensiveren Geruch. Sie sollen oft den Menschen überzeugen, nicht den Hund – der orientiert sich ohnehin stärker am Geruch.
- Künstliche Geschmacksstoffe: verstärken den Geschmack und können minderwertige Rohstoffe überdecken.
Genau hier liegt das größte Risiko: Hunde „gewöhnen“ sich an das künstlich intensivierte Futter und verweigern naturbelassene Alternativen. Außerdem können manche Farbstoffe Allergien, pseudoallergische Reaktionen oder andere gesundheitliche Probleme begünstigen.
Warum du besser auf Hundefutter ohne Zusatzstoffe setzt
Nicht alles, was im Futtermittelrecht erlaubt ist, ist automatisch auch gesund. Viele Zusatzstoffe sind in geringen Mengen unbedenklich, doch die Langzeitwirkungen oder Wechselwirkungen verschiedener Stoffe werden oft nicht ausreichend untersucht. Für sensible Hunde kann das schnell problematisch werden.
Farbstoffe sind ein typisches Beispiel: Sie haben keinerlei ernährungsphysiologischen Nutzen, sondern dienen allein der Optik. Einige, wie E 123 (Amaranth) oder E 127 (Erythrosin), stehen im Verdacht, Allergien, pseudoallergische Reaktionen oder sogar hormonelle Störungen zu fördern. Hunde brauchen keine bunten Kroketten – diese Zusätze sind also völlig überflüssig.
Geschmacksverstärker wie Mononatriumglutamat oder Hefeextrakt können zudem das natürliche Fressverhalten verändern. Sie überdecken minderwertige Zutaten und sorgen dafür, dass Hunde das Futter besonders „lecker“ finden. Die Folge: Manche Tiere entwickeln eine Art Futter-Abhängigkeit und verweigern plötzlich naturbelassene Nahrung ohne künstliche Verstärker.
Künstliche Aromen spielen in die gleiche Richtung. Sie gaukeln einen Fleischgeschmack vor, auch wenn der Fleischanteil im Futter gering ist. So können minderwertige Produkte hochwertiger wirken, als sie tatsächlich sind – ein klarer Nachteil für dich als Hundehalter, weil die Qualität nicht mehr transparent erkennbar ist.
Ein weiteres Risiko stellen Konservierungsstoffe dar. Zwar gibt es natürliche Alternativen (z. B. Vitamin E, Rosmarinextrakt), aber viele Hersteller greifen auf billigere synthetische Varianten zurück. Diese können bei empfindlichen Tieren Magen-Darm-Reizungen oder Hautprobleme hervorrufen.
Zusammengefasst: Auch wenn viele Zusätze gesetzlich erlaubt sind, bringen sie deinem Hund keinen Mehrwert – im Gegenteil, sie bergen gesundheitliche Risiken. Wer auf naturbelassenes Futter setzt, sorgt dafür, dass der Hund echte Nährstoffe bekommt, die er auch wirklich braucht – und keine künstlichen Hilfsstoffe, die nur für Optik oder Industrieprozesse gedacht sind.
Woran erkennst du Futter ohne künstliche Zusätze?
- Kurze Zutatenliste mit klar deklarierten Bestandteilen
- Keine E-Nummern oder schwammige Sammelbegriffe („tierische Nebenerzeugnisse“)
- 100 % Einzelzutaten, naturbelassen
- Transparente Herkunft der Rohstoffe
Fazit
Nicht jeder Zusatzstoff ist grundsätzlich problematisch – aber viele sind unnötig. Wer naturbelassen füttert, kurze Zutatenlisten bevorzugt und auf eine ehrliche Deklaration achtet, reduziert das Risiko für Unverträglichkeiten und hält die Ernährung nah an der Natur des Hundes.
Heidis Hundeliebe: Ehrliche Rezepte für sensible Hunde
Wir entwickeln Futter und Snacks ohne unnötige Zusätze – klar deklariert, schonend hergestellt und ideal für empfindliche Hunde. In unserem Shop findest du:
- Monoprotein-Rezepturen mit transparenter Herkunft
- Futter und Leckerlis ohne Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe
- Getreidefreie Optionen und naturbelassene Kauartikel
Hier zwei passende Empfehlungen:
Mehr naturbelassene Optionen findest du im Shop: heidishundeliebe.de.